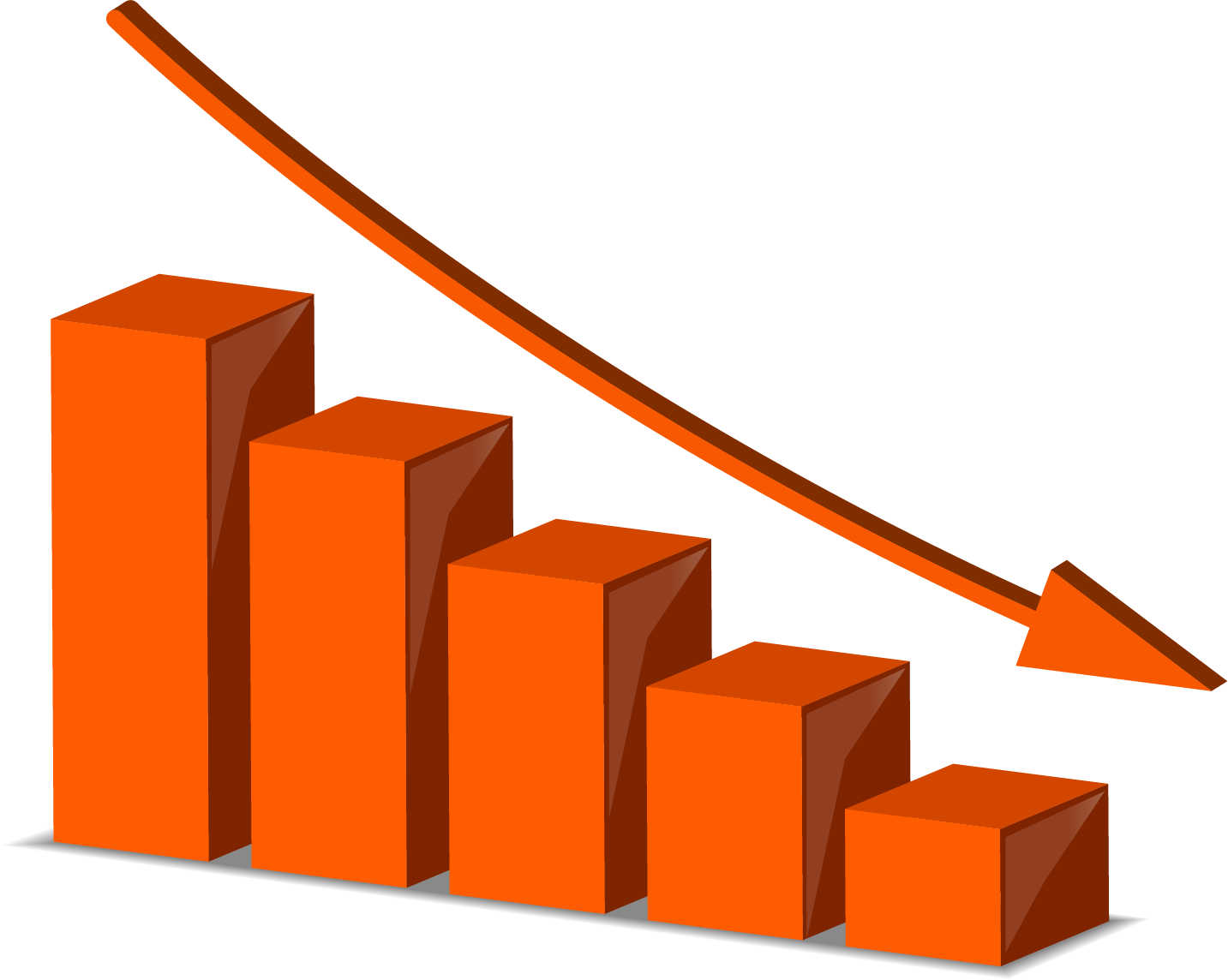Atemwegsprobleme bei Schweinen: Pflanzen als Retter in der Not!

Von Dr. Inge Heinzl, Editor, EW Nutrition
Die heutige intensive Tierhaltung mit hohen Besatzdichten verursacht Stress bei den Tieren und beeinträchtigt das Immunsystem9, 13. Die Zunahme von Atemwegserkrankungen mit den damit verbundenen Verlusten und Kosten ist nur eine der Folgen. Wegen zunehmender Resistenzbildung gegen antimikrobielle Mittel sollten Antibiotika nur in kritischen Fällen eingesetzt werden, daher brauchen wir effektive Alternativen um die Tiere zu unterstützen.
Atemwegsprobleme sind ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren
Er hat bereits einen Namen: Der „Porcine Respiratory Disease Complex“ oder PRDC beschreibt das Zusammenwirken von Viren, Bakterien und nicht-infektiösen Faktoren wie Umweltbedingungen (z. B. schlechte Belüftung), Besatzdichte, Management (z. B. All-in-All-Out nur für Buchten und nicht für den gesamten Stall) und schweinespezifischen Faktoren wie Alter und Genetik, die alle zusammen Atemwegsprobleme bei Schweinen verursachen. Nicht infektiöse Faktoren wie hohe Ammoniakwerte schwächen das Immunsystem und legen den Grundstein für z. B. Mykoplasmen, die die erste Verteidigungslinie, die Flimmerepithelzellen, in den oberen Atemwegen schädigen und den Weg für PRRS-Viren ebnen. Diese gelangen ihrerseits, eingebettet im eingeatmeten Staub, in die Atemwege. Dort schädigen sie die Makrophagen und durchbrechen die nächste Abwehrbarriere. Eine weitere Ursache ist das Porzine Circovirus 2 (PCV2), das spezifische Immunzellen zerstört und zu einer allgemein höheren Anfälligkeit für Infektionen führt.
Im weiteren Verlauf können Bakterien wie Pasteurella multocida oder Streptococcus suis Sekundärinfektionen verursachen7, 20, 22. Auch die Kombination von Mycoplasma hyopneumoniae und dem porcinen Circovirus, beides typischerweise nur gering-pathogene Organismen, führt zu schweren Atemwegserkrankungen15.
Eingeschränkte Atmungsfunktion beeinträchtigt das Wachstum
Die Hauptaufgaben der Atemwege sind die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und die Abgabe von CO2, das beim Abbau von Gewebe entsteht. Da Schweine keine Schweißdrüsen haben, ist bei ihnen der Atemtrakt jedoch auch für die Wärmeregulierung zuständig. Die Tiere müssen die überschüssige Wärme durch schnelles Atmen loswerden. Ist die Atmungsfunktion krankheitsbedingt beeinträchtigt, ist die Fähigkeit zur Wärmeregulierung reduziert. Die daraus resultierende geringere Futteraufnahme führt zu einer schlechteren Wachstumsleistung und einer geringeren Wirtschaftlichkeit17.
Eine der ersten Studien zu diesem Thema wurde von Straw et al. durchgeführt. (1989)21. Sie stellten fest, dass pro 10 % mehr betroffenem Lungengewebe die tägliche Zunahme um etwa 37 g abnahm. Diese negative Korrelation zwischen infiziertem Lungengewebe und Gewichtszunahme konnte von Paz-Sánchez et al. bestätigt werden (2021)18. Sie sahen, dass Tiere, bei denen mehr als 10% des Lungenparenchyms von cranioventraler Bronchopneumonie (CBP) befallen waren, eine längere Zeit bis zur Vermarktung benötigten (208,8 Tage vs. 200,8 Tage bei der Kontrolle), ein geringeres Schlachtgewicht aufwiesen (74,1 kg vs. 77,7 kg in der Kontrollgruppe) und damit auch eine geringere Tageszunahme (500,8 g/Tag im Vergleich zu 567,2 g/Tag). In einer anderen Studie untersuchten Pagot und Mitarbeiter (2007)16 7000 Schweine aus 14 französischen Betrieben. Sie stellten eine signifikant negative Korrelation (p<0,001) zwischen dem Vorkommen von Lungenentzündungen und dem Wachstum fest, und sahen eine Gewichtsreduktion von 0.7 mit jedem Punkt stärkerer Pneumonie.
Pflanzenextrakte unterstützen Schweine über verschiedene Wirkmechanismen
Schon immer haben Menschen pflanzliche Stoffe zur Heilung von Krankheiten eingesetzt, sei es Weidenrinde gegen Schmerzen, Kamille gegen Entzündungen oder Magenverstimmungen. Spitzwegerich und Thymian werden als Hustenstiller verwendet, und Eukalyptus und Menthol helfen beim Durchatmen. Was für Menschen gut ist, kann auch für Schweine verwendet werden. Um Pflanzenextrakte effektiv einsetzen zu können, ist es wichtig, ihre spezifischen Wirkungsweisen zu kennen. Dank ihrer flüchtigen Natur können ätherische Öle durch Inhalation direkt an den Zielort, die Atemwege, gelangen.1
1. Pflanzenextrakte können antimikrobiell wirken
Viele ätherische Öle zeigen ein gewisses Maß an antimikrobieller Aktivität. So sind die Öle von z. B. Oregano, Teebaum, Zitronengras, Zitronenmyrte und Nelke wirksam gegen eine Vielzahl von grampositiven und gramnegativen Bakterien. LeBel et al. (2019)12 testeten neun verschiedene Öle gegen Mikroorganismen, die bei Schweinen Atemwegsprobleme verursachen. Sie stellten für die Öle von Zimt, Thymian und Winterbohnenkraut die höchste Wirksamkeit gegen Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus suis, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis und Pasteurella multocida fest, mit minimalen Hemm- (MHKs) und minimalen bakteriziden Konzentrationen (MBKs) von 0,01 bis 0,156 %.
Aber, es kommt nicht nur auf die direkte bakterizide Wirkung an. 1,8-Cineol, z.B., hat nur eine geringe oder keine antimikrobielle Wirkung10, macht aber die Bakterienmembranen2 durchlässig und ermöglicht so das Eindringen anderer schädlicher Stoffe in die Bakterienzelle. Jedoch verfügt Cineol über bemerkenswerte antivirale Eigenschaften.
2. Pflanzenextrakte können schleimlösend, spasmolytisch oder hustenstillend wirken
Bei Erkrankungen der Atemwege sorgen die schleimlösenden und krampflösenden Eigenschaften von Phytomolekülen für eine gute Atmung. Mukolytische Substanzen lösen den Schleim, machen ihn flüssiger und erleichtern den Abtransport aus den Atemwegen durch das Flimmerepithel. Da die Verflüssigung des Schleims durch ätherische Öle oder Phytomoleküle mit lokalen Reizungen verbunden ist, sind Dosierung und Anwendungsform von höchster Bedeutung.5
Diese “Säuberung” der Atemwege wird als mukoziliäre Clearance bezeichnet. Es gibt auch Substanzen, die den Schleim nicht auflösen, sondern den mukoziliären Transportmechanismus stimulieren und die Transportgeschwindigkeit erhöhen1.
Eine spasmolytische Wirkung auf die glatte Muskulatur der Atemwege haben beispielsweise Menthol8 oder das ätherische Öl von Eukalyptus tereticornis4. Menthol zeigt eine hustenstillende Wirkung11.
3. Pflanzenextrakte können immunmodulatorisch und entzündungshemmend wirken
Wenn Tiere an einer Atemwegserkrankung leiden oder Gefahr laufen, sich anzustecken, ist es hilfreich, das Immunsystem zu unterstützen. Zum einen verbessert es die Wirkung von Impfungen. Mieres-Castro et al. (2021)14 verglichen die kombinierte Verabreichung von einem Grippeimpfstoff mit Cineol bei Mäusen mit einer Impfung ohne Cineol. Die Kombination führte zu längerer Überlebenszeit, weniger Entzündungen, geringerem Gewichtsverlust, einer niedrigeren Sterblichkeitsrate, weniger Lungenödemen und niedrigeren Titern, wenn die Tiere sieben Tage nach der Impfung mit dem Virus infiziert wurden.
Sind die Tiere andererseits bereits krank, ist eine Stärkung der Immunabwehr unerlässlich. Li et al. (2012)13 zeigten, dass im Plasma von Schweinen die Interleukin-6-Konzentration niedriger (p<0,05) und der Tumor-Nekrose-Faktor-α-Spiegel höher (p<0,05) war, wenn die Tiere Futter mit 0,18 % Thymol und Zimtaldehyd erhielten. Außerdem vermehrten sich bei den mit Thymol und Zimtaldehyd gefütterten Schweinen die Lymphozyten, signifikant stärker als in der Negativkontrolle (p<0,05).
4. Pflanzenextrakte können als Antioxidantien wirken
Es gibt Erkrankungen der Atemwege, bei denen reaktive Sauerstoffspezies (ROS) eine wichtige Rolle spielen. In diesen Fällen ist die antioxidative Wirkung von Phytomolekülen von Interesse. Der Versuch von Li et al. (2012)13 zeigte, dass eine Formulierung mit 0,18 % Thymol und Zimtaldehyd die antioxidative Gesamtkapazität (p<0,05) bei Schweinen im Vergleich zu einer negativen Kontrollgruppe erhöhte.
Can Baser & Buchbauer (2010) beschrieben, dass Eukalyptusöl, das 1,8-Cineol, die Monoterpenkohlenwasserstoffe α-Pinen (10-12 %), p-Cymol und α-Terpinen sowie den Monoterpenalkohol Linalool enthält, zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege eingesetzt wird, bei denen ROS eine wichtige Rolle spielen.
5. Pflanzenextrakte reduzieren die Ammoniakproduktion
Eine hohe Ammoniakkonzentration im Schweinestall belastet die Atemwege der Schweine und macht sie anfällig für Krankheiten. Ammoniak entsteht, wenn sich Kot und Urin vermischen und das Enzym Urease für deren Abbau sorgt. Yucca-Extrakt mit einem hohen Anteil an Saponinen kann die Ammoniakemissionen in den Ställen verringern. Ehrlinger (2007)5 vermutet, dass die Glykokomponenten von Saponinen Ammoniak und andere schädliche Gase binden. Eine andere Erklärung kann die in einem Versuch mit Ratten19 nachgewiesene verringerte Aktivität der Urease oder die Verringerung des Gesamtstickstoffs, des Harnstoffstickstoffs und des Ammoniakstickstoffs im Sauenmist3 sein.
6. Pflanzenextrakte zeigen oft unterschiedliche Wirkungen bei Atemwegserkrankungen
Aufgrund ihrer natürlichen Aufgabe – dem Schutz der Pflanze – zeigen ätherische Öle in der Regel nicht nur eine für uns vorteilhafte Wirkung. Camphen, zum Beispiel in Thymus vulgaris, hat schleimlösende, krampflösende und antimikrobielle Eigenschaften und wird zur Behandlung von Atemwegsinfektionen eingesetzt. Aufgrund seines bronchodilatatorischen Effekts, seiner Wechselwirkung mit den Kälterezeptoren und der Aktivierung der Atmung kann Menthol wirksam bei Asthma eingesetzt werden. In niedriger Konzentration wirkt Menthol hustenstillend, erweckt den Eindruck der Abschwellung und reduziert damit Atemwegsbeschwerden und das Gefühl der Atemnot.
Cineol seinerseits wirkt antimikrobiell, hustenstillend, bronchienerweiternd, schleimlösend und entzündungshemmend. Es fördert den Ziliartransport und verbessert die Lungenfunktion1, 6 . Thymol wird eine schleimlösende, antioxidative, antivirale und antibakterielle Wirkung zugeschrieben5.
Studie zeigt: Phytomoleküle helfen, Atemwegserkrankungen in Schach zu halten
In einem philippinischen Ferkelzuchtbetrieb, in dem chronische Atemwegsprobleme während der Wachstumsphase mit einer Morbidität von etwa 10-15 % auftraten, wurde eine Feldstudie durchgeführt. Es wurde ein Flüssigprodukt mit Phytomolekülen, die die Tiere gegen Erkrankungen der Atemwege unterstützen (Grippozon), getestet. Für den Versuch wurden 360 zufällig ausgewählte 28 Tage alte Schweine (Durchschnittsgewicht: 6,64±0,44 kg) in zwei Gruppen mit 6 Wiederholungen pro Gruppe und 30 Ferkeln pro Wiederholung aufgeteilt. Alle Ferkel stammten von Sauen, die antibiotikafrei aufgezogen wurden. Die Ferkel erhielten auch nach dem Absetzen keine Antibiotika, es sei denn, es traten Symptome auf (bei Durchfall: Baytril-1 mL /Schwein; Atemwegserkrankungen: Excede – 1mL/Schwein). Alle Ferkel bekamen das gleiche Futter und eine regelmäßige Prophylaxe über die Tränke:
| Woche 1 (1. Woche nach dem Absetzen): | • Multivitamine, Aminosäuren – 200-400 g/1000 L Wasser
• Säuerungsmittel I (Zitronensäure + Enzym) für die Tränke – 2 L/1000 L |
| Woche 2-10: | • Säuerungsmittel II (Zitronensäure) für die Tränke – 300-400 mL/1000 L) |
Kontrollgruppe: kein zusätzliches Flüssigprodukt zum Wasser
Grippozon-Gruppe: Zugabe von 250 mL Grippozon pro 1000 L Wasser
Beobachtete Parameter waren das Auftreten von Atemwegserkrankungen, Endgewicht, tägliche Zunahmen, Futterverwertung (FVW) und Kosten für Antibiotika.

Die Zugabe von Grippozon verringerte das Auftreten von Atemwegserkrankungen um 52 %, was als Folge zu einer Senkung der Kosten für Antibiotikabehandlungen um 53 % führte. Die Tiere zeigten zudem eine bessere Wachstumsleistung (600 g höheres Durchschnittsgewicht und 13 g höhere durchschnittliche Tageszunahme). Dies führte insgesamt zu einem zusätzlichen Ertrag von 1,76 US$ pro Schwein.
Grippozon unterstützt die Schweine gegen Atemwegserkrankungen, reduziert Krankheitsfälle und damit den Einsatz von Medikamenten. Die gesünderen Schweine aus der mit Grippozon versorgten Gruppe können eine höhere Leistung und damit einen höheren Betriebsertrag erbringen.
Wir haben die Mittel, um den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren
Atemwegserkrankungen sind ein großes Problem bei Schweinen. Da Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel nach wie vor stark verbreitet sind, muss der Einsatz von Antibiotika so weit wie möglich reduziert werden. Phytomoleküle bieten die Möglichkeit, die Gesundheit der Tiere zu stärken, so dass sie weniger anfällig für Krankheiten sind, oder sie zu unterstützen, wenn sie bereits infiziert sind. Mit Hilfe von Phytomolekülen können wir Antibiotikabehandlungen reduzieren und dazu beitragen, dass diese Medikamente wirksam sind, wenn ihr Einsatz unerlässlich ist.
Referenzen
- Can Baser , K. Hüsnü, and Gerhard Buchbauer. Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications. Boca Raton, FL: Taylor & Francis distributor, 2010.
- Carson, Christine F., Brian J. Mee, and Thomas V. Riley. “Mechanism of Action of Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil on Staphylococcus Aureus Determined by Time-Kill, Lysis, Leakage, and Salt Tolerance Assays and Electron Microscopy.” Antimicrobial Agents and Chemotherapy 46, no. 6 (2002): 1914–20. https://doi.org/10.1128/aac.46.6.1914-1920.2002.
- Chen, Fang, Yantao Lv, Pengwei Zhu, Chang Cui, Caichi Wu, Jun Chen, Shihai Zhang, and Wutai Guan. “Dietary Yucca Schidigera Extract Supplementation during Late Gestating and Lactating Sows Improves Animal Performance, Nutrient Digestibility, and Manure Ammonia Emission.” Frontiers in Veterinary Science 8 (2021). https://doi.org/10.3389/fvets.2021.676324.
- Coelho-de-Souza, Lívia Noronha, José Henrique Leal-Cardoso, Francisco José de Abreu Matos, Saad Lahlou, and Pedro Jorge Magalhães. “Relaxant Effects of the Essential Oil of Eucalyptus Tereticornisand Its Main Constituent 1,8-Cineole on Guinea-Pig Tracheal Smooth Muscle.” Planta Medica 71, no. 12 (2005): 1173–75. https://doi.org/10.1055/s-2005-873173.
- Ehrlinger, Miriam. “Phytogene Zusatzstoffe in der Tierernährung.” Dissertation, Tierärztliche Fakultät LMU, 2007.
- Gelbe Liste Online. “Gelbe Liste Pharmindex Online.” Gelbe Liste. Accessed January 20, 2023. https://www.gelbe-liste.de/.
- Hennig-Pauka, Isabell. “Atemwegserkrankungen: Schutz fängt schon bei Ferkeln an.” Der Hoftierarzt, January 13, 2021. https://derhoftierarzt.de/2021/01/atemwegserkrankungen-schutz-faengt-schon-bei-ferkeln-an/.
- Ito, Satoru, Hiroaki Kume, Akira Shiraki, Masashi Kondo, Yasushi Makino, Kaichiro Kamiya, and Yoshinori Hasegawa. “Inhibition by the Cold Receptor Agonists Menthol and ICILIN of Airway Smooth Muscle Contraction.” Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 21, no. 5 (2008): 812–17. https://doi.org/10.1016/j.pupt.2008.07.001.
- Kim, K.H., E.S. Cho, K.S. Kim, J.E. Kim, K.H. Seol, S.J. Sa, Y.M. Kim, and Y.H. Kim. “Effects of Stocking Density on Growth Performance, Carcass Grade and Immunity of Pigs Housed in Sawdust Fermentative Pigsties.” South African Journal of Animal Science 46, no. 3 (2016): 294–301. https://doi.org/10.4314/sajas.v46i3.9.
- Kotan, Recep, Saban Kordali, and Ahmet Cakir. “Screening of Antibacterial Activities of Twenty-One Oxygenated Monoterpenes.” Zeitschrift für Naturforschung C 62, no. 7-8 (2007): 507–13. https://doi.org/10.1515/znc-2007-7-808.
- Laude, E.A., A.H. Morice, and T.J. Grattan. “The Antitussive Effects of Menthol, Camphor, and Cineole in Conscious Guinea-Pigs.” Pulmonary Pharmacology 7, no. 3 (1994): 179–84. https://doi.org/10.1006/pulp.1994.1021.
- LeBel, Geneviève, Katy Vaillancourt, Philippe Bercier, and Daniel Grenier. “Antibacterial Activity against Porcine Respiratory Bacterial Pathogens and in Vitro Biocompatibility of Essential Oils.” Archives of Microbiology 201, no. 6 (2019): 833–40. https://doi.org/10.1007/s00203-019-01655-7.
- Li, Xue, Xia Xiong, Xin Wu, Gang Liu, Kai Zhou, and Yulong Yin. “Effects of Stocking Density on Growth Performance, Blood Parameters and Immunity of Growing Pigs.” Animal Nutrition 6, no. 4 (2020): 529–34. https://doi.org/10.1016/j.aninu.2020.04.001.
- Mieres-Castro, Daniel, Sunny Ahmar, Rubab Shabbir, and Freddy Mora-Poblete. “Antiviral Activities of Eucalyptus Essential Oils: Their Effectiveness as Therapeutic Targets against Human Viruses.” Pharmaceuticals 14, no. 12 (2021): 1210. https://doi.org/10.3390/ph14121210.
- Opriessnig, T., L. G. Giménez-Lirola, and P. G. Halbur. “Polymicrobial Respiratory Disease in Pigs.” Animal Health Research Reviews 12, no. 2 (2011): 133–48. https://doi.org/10.1017/s1466252311000120.
- Pagot, E., P. Keita, and A. Pommier. “Relationship between Growth during the Fattening Period and Lung Lesions at Slaughter in Swine.” Revue Méd. Vét., , , 5, 253-259 158, no. 5 (2007): 253–59.
- Pallarés Martínez, Francisco José, Jaime Gómez Laguna, Inés Ruedas Torres, José María Sánchez Carvajal, Fernanda Isabel Larenas Muñoz, Irene Magdalena Rodríguez-Gómez, and Librado Carrasco Otero. “The Economic Impact of Pneumonia Processes in Pigs.” https://www.pig333.com. Pig333.com Professional Pig Community, December 14, 2020. https://www.pig333.com/articles/the-economic-impact-of-pneumonia-processes-in-pigs_16470/.
- Paz-Sánchez, Yania, Pedro Herráez, Óscar Quesada-Canales, Carlos G. Poveda, Josué Díaz-Delgado, María del Quintana-Montesdeoca, Elena Plamenova Stefanova, and Marisa Andrada. “Assessment of Lung Disease in Finishing Pigs at Slaughter: Pulmonary Lesions and Implications on Productivity Parameters.” Animals 11, no. 12 (2021): 3604. https://doi.org/10.3390/ani11123604.
- Preston, R. L., S. J. Bartle, T. May, and S. R. Goodall. “Influence of Sarsaponin on Growth, Feed and Nitrogen Utilization in Growing Male Rats Fed Diets with Added Urea or Protein.” Journal of Animal Science 65, no. 2 (1987): 481–87. https://doi.org/10.2527/jas1987.652481x.
- Ruggeri, Jessica, Cristian Salogni, Stefano Giovannini, Nicoletta Vitale, Maria Beatrice Boniotti, Attilio Corradi, Paolo Pozzi, Paolo Pasquali, and Giovanni Loris Alborali. “Association between Infectious Agents and Lesions in Post-Weaned Piglets and Fattening Heavy Pigs with Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).” Frontiers in Veterinary Science 7 (2020). https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00636.
- Straw , B. E., V. K. Tuovinen, and M. Bigras-Poulin. “Estimation of the Cost of Pneumonia in Swine Herds.” J Am Vet Med Assoc. 1989 Dec 15;195(12):1702-6. 195, no. 12 (December 15, 1989): 1702–6.
- White, Mark. “Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).” Livestock 16, no. 2 (2011): 40–42. https://doi.org/10.1111/j.2044-3870.2010.00025.x.
Herden”. J Am Vet Med Assoc. 1989 Dec 15;195(12):1702-6. 195, Nr. 12 (Dezember 15, 1989): 1702–6.
- White, Mark. “Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC)”. Viehzucht 16, Nr. 2 (2011): 40–42. https://doi.org/10.1111/j.2044-3870.2010.00025.x.